Johann Mielich (GND 118783815)
| Daten | |
| Nachname | Mielich |
| Vorname | Johann |
| GND | 118783815 ( DNB ) |
| Wirkungsgebiet | Kunst |
Mielich, (Johann) ein vortrefflicher Miniatür- und Oelmaler in München, wurde 1515 geboren. In der Pfarrkirche zu U. L. Fr. befindet sich unter dem großen Musikchore das jüngste Gericht von ihm, sehr schön, nach jenem des Michael Angelo Bonaroti gemalt, dann der Kanzel gegenüber ein Oelberg, schön kolorirt, auf Leinwand. In der Kgl. Hofbibliothek zu München zeigt man zwei Bände von Atlasformat, die von der Hand dieses Künstlers mit unzähligen Gemälden geziert sind. Das größte dieser Bücher soll 3500 Thaler gekostet haben. Zu Ingolstadt sind die Gemälde auf kupfernen Platten am Hochaltar, den H. Albrecht 1572 setzen ließ, von ihm gemalt, und auf dem dortigen Rathhause ist ein seltener Holzstich, das Feldlager der schmalkaldischen Bundesarmee bei Ingolstadt vorstellend, verwahrt, wovon die Zeichnung von Mielich, der Druck aber von Christoph Zwickhof ist. Westenrieder S. 183. u. 364. v. Rittersausen S. 91. Mein Bürgermilitär-Alman. Jahrg. 1810. S. 86 u. 89 in den Noten. Er starb zu München 1572. Die Königl. Gallerie besitzt von seinem Pinsel: das Bildniß einer Frau in schwarzer Kleidung, auf Holz, und das eines Mannes in schwarzer Kleidung mit Pelz ausgeschlagen, ebenfalls auf Holz gemalt. Christ. Mannlich Beschreibung der churb. Gemäldesamml. B. II. Nro. 108. u. 121. Joh. Ludw. Bianconi Briefe. (Leipz. 1764) Br. 3. S. 28. 32.
Nachtrag aus: Lipowsky Künstler II
Mielich (Johann). In einer alten Rechnung v. J. 1572 heißt es: „mit Hanns Mielich wegen der gemachten herrb. Chortafel gen U. L. Frauenkirche zu Ingolstadt Abraitung getroffen mit 2200 Gulden --“ Das ovale Bildniß dieses Künstlers hat F. Xav. Jungwirth 1760 in Oktavformat in Kupfer gestochen. Dieß als Ergänzung zu diesem B. I. S. 206. vorkommenden Künstler. v. Kretz Mspt.
Vorheriger Eintrag |
  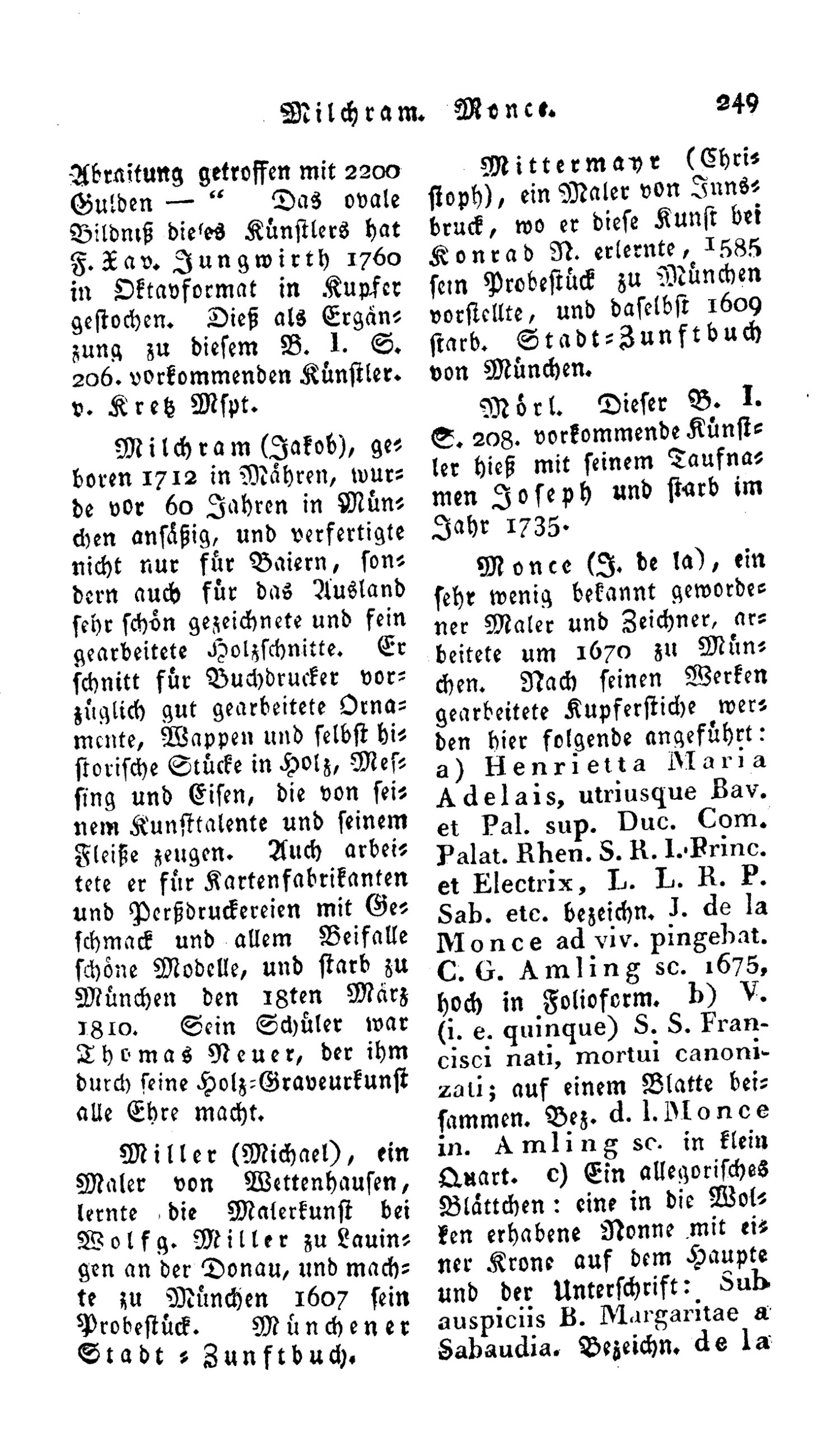
|
Nächster Eintrag |
Fußnoten
- ↑ Es ist dieses Gemälde eigentlich das Grabmal des Leonard von Ecky, und war in der Franziskaner-Kirche zu München. Als deren Demolirung beschlossen war, wurde auch dieses Gemälde feilgeboten. Glücklicherweise konnte ich den Verkauf verhindern, weil eben auch der Kanonikus v. Hertel dazu kam, der als damaliger Kustos der Stiftskirche zu U. L. Frau mit aller Theilnahme sich anbot, dieses Gemälde zu übernehmen, und in genannter Kirche aufzuhängen, und so entschwand es den Klauen eines Trödlers, und wurde erhalten. Eine umständliche und kritische Beschreibung dieses jüngsten Gerichtes von Michael Angelo Buonaroti ist in J. G. Fiorillo’s Geschichte der Malerei (Göttingen 1798) Chl. I. S. 364--396 zu lesen. Nicht unwillkommen dürften indessen hier folgende Anekdoten seyn: Der Carron zu dem jüngsten Gerichte war schon unter Clemens VII. angefangen. Das Gemälde selbst aber begann er 1534 unter Pabst Paul III., und vollendete dasselbe 1541. Aber schon vor dieser Zeit, da es unten noch nicht ganz ausgemalt war, besah es der Pabst mit einem zahlreichen Gefolge. Paul III. fragte bei dieser Gelegenheit den Ceremonienmeister Messer Biagio da Cesena: wie ihm dieses Gemälde gefiel? und dieser tadelte es, wegen seiner zu vielen Naktheit bei männlichen und weiblichen Körpern in sehr heftigen Ausdrücken. Michael Angelo hierüber aufgebracht, bildete nun diesen Sittenrichter als ein Ungeheuer nach des Dante Dichtung mit einem grossen Schlangen-Schweife in diesem Gemälde, und versetzte ihn in die Hölle. Der Ceremonienmeister beschwerte sich über diese ihm zugefügte Unbild beim Pabste, der ihm aber lächelnd antwortete: wären Sie vom Michael Angelo in das Fegfeuer versetzt, so hätte ich Sie dort befreien können; da er Sie aber in die Hölle stieß, so ist mir Ihre Rettung nicht möglich, denn aus der Hölle ist keine Erlösung. So dachte Paul III.; nicht so sein Nachfolger Paul IV. Dieser ärgerte sich über die Indecenz der nakten Figuren, und wollte das Bild ganz vertilgen; allein mehrere Kardinäle stellten ihm vor, daß es ein unverzeihliches Vergehen wäre, solch ein großes Kunststück zu vernichten. Es wurde daher beliebt, die zu nackten Figuren durch Daniel von Voltera, einem Schüler des Buonaroti, mit feinen Tüchern bedecken zu lassen. Es geschah, und Daniel von Voltera erhielt deßwegen den Spottnamen Brachettone (Hosenmacher). Casparo Celio Memorie etc. (Napoli 1638) p. 16.