Johann d. Ä. Holbein (GND 118552945)
| Daten | |
| Nachname | Holbein |
| Vorname | Johann d. Ä. |
| GND | 118552945 ( DNB ) |
| Wirkungsgebiet | Kunst |
Holbein, (Johann) der ältere, ein Bürger und Maler zu Augsburg, wo er um das Jahr 1450 geboren wurde, zeigte schon in seiner frühen Jugend Anlage zur Malerkunst; indem er für das dortige Rathhaus und die Stadtbibliothek schöne Gemälde verfertigte. Für die Klosterkirche zu Kaisersheim malte er um das Jahr 1500 einen großen Choraltar, den Abt Georg setzen ließ, auf Holz. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde statt dieses Altars ein neuer gesetzt, und die Gemälde davon kamen in die königl. baierische Gallerie. In der Katharinenkirche zu Augsburg sind die Altarblätter: der englische Gruß und der Apostel Paul von ihm. v. Sandrart. S. 249. v. Stetten. S. 273. Holbein besaß einen guten Geschmack, der alle Mängel der deutschen Manier sorgfältig vermied. Seine Bilder sind wahr, und seine Zusammensetzung verräth eine lebhafte, erhabene Einbildungskraft und eine schöne Ausarbeitung. Sein Kolorit ist kräftig, sein Fleisch lebhaft, und seine Figuren sind erhoben gehalten; nur ist sein Stil steif, und die Falten seiner Kleider sind schlecht geordnet und gehalten. Er zeichnete auch vieles für Goldarbeiter, Kupferstecher und Formschneider. Die königl. baier. Gallerie besitzt von seinem Pinsel das Brustbild des Hans Strauch in schwarzer Kleidung auf Holz, dann die Kreutzerhebung Christi mit zwei Seitenflügeln. Auf dem einen der Abschied Christi von seiner Mutter, und auf dem andern die Auferstehung, ganze Figuren auf Holz. In der königl. Residenz zu München hängen mehrere Gemälde von diesem Künstler. Füßli am a. O. B. I. S. 10. Weitzenfeld Beschreibung der churfürstl. Bildergallerie zu Schleißheim Nro. 875. u. 1029. v. Rittersausen Merkwürdigkeiten von München S. 43. v. Mannlich am a. O. B. I. S. 212. u. B. II. Nro. 168.
Nachtrag aus: Lipowsky Künstler II
Holbein (Johann), Vater und Sohn, waren auch Formschneider. Nach Papillons Meinung war Holbein der Sohn der größte Künstler im Formschneiden, welche Kunst er schon im 16ten Jahre seines Alters zu üben begann. Die Blätter, die er für das Lob der Narrheit seinem Freunde Erasmus gezeichnet und gestochen hat, sind bekannt; allein die Originalien fangen an selten zu werden. Seinen berühmten Todtentanz, den er zu Basel malte, und wovon die Originalzeichnungen in dortiger Stadt-Bibliothek verwahrt werden, schnitt er in der Folge in Holz. Die ersten Abdrücke hiervon sind nur auf einer Seite abgedruckt. Vorzüglich sind auch 90 Blätter, welche historische Gegenstände aus dem alten Testamente vorstellen, berühmt. Die beste Ausgabe von diesem Werke ist v. J. 1589 zu Lion bei den Brüdern Melchior und Kaspar Trechsel herausgekommen. C. C. H. Rost, eigentlich M. Hubers Handbuch für Kunstliebh. (Zürich 1796) B. I. S. 147.
Vorheriger Eintrag |
 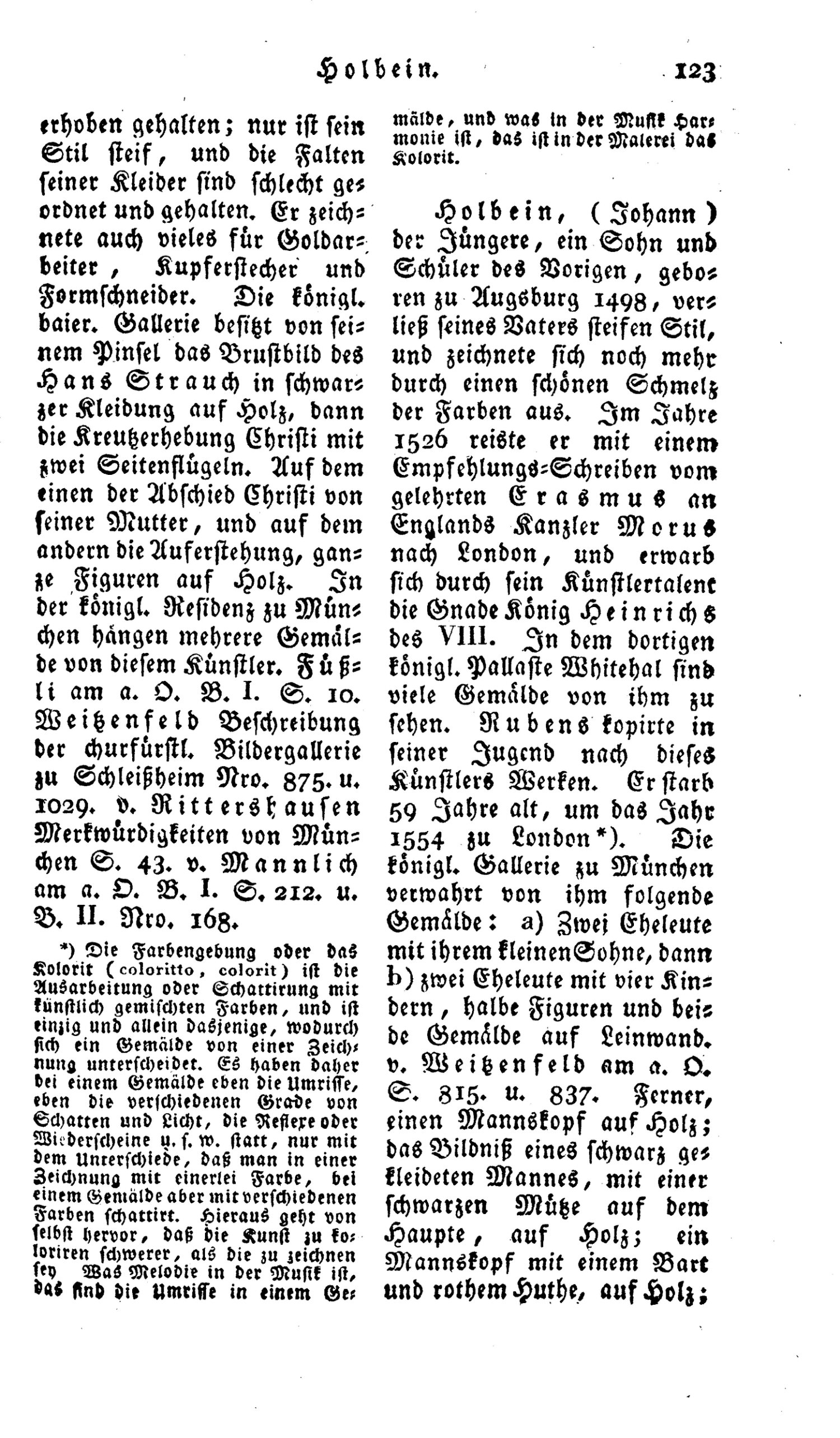  
|
Nächster Eintrag |
Fußnoten
- ↑ Die Farbengebung oder das Kolorit (coloritto, colorit) ist die Ausarbeitung oder Schattirung mit künstlich gemischten Farben, und ist einzig und allein dasjenige, wodurch sich ein Gemälde von einer Zeichnung unterscheidet. Es haben daher bei einem Gemälde eben die Umrisse, eben die verschiedenen Grade von Schatten und Licht, die Reflexe oder Wiederscheine u. s. w. statt, nur mit dem Unterschiede, daß man in einer Zeichnung mit einerlei Farbe, bei einem Gemälde aber mit verschiedenen Farben schattirt. Hieraus geht von selbst hervor, daß die Kunst zu koloriren schwerer, als die zu zeichnen sey Was Melodie in der Musik ist, das sind die Umrisse in einem Gemälde, und was in der Musik Harmonie ist, das ist in der Malerei das Kolorit.