Cölestin Steiglehner (GND 117237655)
| Daten | |
| Nachname | Steiglehner |
| Vorname | Cölestin |
| GND | 117237655 ( DNB ) |
| Wirkungsgebiet | Wissenschaft |
STEIGLEHNER (Cölestin) Fürst und Abt zu St. Emmeram in Regensburg. Er wurde den 17. August 1738 zu Sündersbühel bei Nürnberg, wo sein Vater ein Wundarzt war, gebohren, und erhielt in der Taufe die Nahmen Georg Christoph, worauf ihm erst nach dem Eintritt in den Benediktinerorden der Klosternahme Cölestin ertheilt ward. Der junge Steiglehner erhielt den ersten Unterricht von seinem Vater, und wurde im J. 1748 in das teutsche Haus zu Nürnberg als Singknabe aufgenohmen, wo ihm die 3 Geistliche, die der teutsche Ritterorden in diesem Hause unterhielt, gründliche Kenntnisse in der lateinischen Sprache, in der Musik, und im Zeichnen beibrachten. Im Herbste 1752 wurde er in das Studentenseminar zu St. Emmeram in Regensburg aufgenohmen, trat, da er am Bischöflichen Gymnasium die 6 Klassen absolvirt hatte, in dem fürstlichen Reichsstifte zu St. Emmeram in den Benediktinerorden, legte den 4. November 1759 die Ordensgelübde ab, und las am 2. Oktober 1763 seine erste Messe. Nachdem er seit 1758 Philosophie, Mathematik, Geschichte, Sprachen, Theologie, und Kirchenrecht studirt hatte, vollendete er 1764 den theologischen Kursus, und wurde im Dezember desselben Jahres als Hilfspriester an der obern Stadtpfarrkirche zu Regensburg, 1765 aber als Pfarrer zu Schnabelweis angestellt. Im J. 1766 wurde Steiglehner in seinem Stifte St. Emmeram zu Regensburg zum Professor ernannt, und ihm das Physikalisch mathematische Fach übertragen. Er gab von dieser Zeit an Unterricht in der reinen und angewandten Mathematik, in der theoretischen und Experimentalphysik, in der Meteorologie, und Astronomie. Seit 1771 beschäftigte er sich auch mit der praktischen Witterungskunde, und es wurde von ihm und seinen Mitbrüdern ein sehr genaues meteorologisches Tagebuch geführt. Als daher die meteorologischen Gesellschaften in Mannheim und München erst entstanden, hatte das Kloster St. Emmeram in Regensburg bereits das erste Dezennium geschloßen. Die spätern St. Emmeramer Beobachtungen von 1781 bis 1792 wurden den Mannheimer Ephemeriden einverleibt. Während Steiglehner täglich über Physik und Mathematik Vorlesungen zu halten, und auch die Leitung des Studentenseminars zu führen hatte, studirte er die orientalische Sprachen, Numismatik, Archäologie, Baukunst, und übte sich fortwährend in der Musik, und im Zeichnen. Auch ließ er bis in sein hohes Alter keinen Tag vorüber gehen, ohne einige Stellen aus einem griechischen Klassiker gelesen zu haben. Im Oktober 1781 erhielt er den Ruf an die Universität zu Ingolstadt als ordentlicher Professor der Mathematik, Experimentalphysik, und Astronomie, wurde Doktor der Philosophie und Theologie, und Kurfürstl. geistlicher Rath. An der Universität verbesserte er die Sternwarte, und bereicherte das physikalische Kabinet mit einem vollkommneren Apparat. Er bewies sich als einen Lehrer, wie Ingolstadt vor ihm in seinem Fache nur sehr wenige hatte. Sein gründlicher, höchst deutlicher und gemeinnütziger Vortrag verschaffte ihm Zuhörer aus allen Fakultäten, und Beamte, so wie die meisten Offiziere der Garnison, waren unter seinen Zuhörern. Er genoß die Achtung aller seiner Kollegen, und die Liebe der Studierenden. Den nach Mannheim erhaltenen Ruf als Hofastronom lehnte er ab. Der an gelehrten Kenntnissen reiche Steiglehner hätte Vieles zum Drucke befördern können; aber er war kein Liebhaber der Schriftstellerei, und widmete sich ausschlüssig seinen Studien und seinen Vorlesungen. Auch zu Ingolstadt war er, wie früher in seinem Kloster, immer entweder am Studierpulte, oder im Hörsaal, oder auf dem Observatorium. Es war eine Seltenheit, wenn er sich einen Spatziergang erlaubte, und selbst die Herbstferien brachte er in Ingolstadt zu, um seine meteorologischen und astronomischen Beobachtungen nicht zu unterbrechen. Von der Baierischen Akademie der Wissenschaften in München wurde er im Jahre 1790 als Mitglied der physikalischen Klasse ernannt, und auch die Akademie der Wissenschaften in Mannheim, so wie mehrere andere gelehrte Gesellschaften, nahmen ihn unter ihre Mitglieder auf. Am 1. Dezember 1791 wurde Cölestin Steiglehner zum Fürstabten des Kaiserlichen freien Reichsstiftes und Benediktinerklosters von St. Emmeram zu Regensburg erwählet, und dadurch zu der hohen Würde eines Reichsfürsten und infulirten Prälaten erhoben. Er machte im Stifte die zweckmässigsten Einrichtungen, vollendete den Bau der Abtei, vermehrte die Bibliothek, und die sämtlichen literarischen und Kunstsammlungen, sorgte für genaue Administration der Finanzen, für zweckmäßige Studien der Klostergeistlichen, für Ordnung in allen Rubriken, und für Observanz der Ordens und Klostergesetze. Er bereisete die beträchtliche Güter und Hofmarken des Stiftes, kontrollirte die Verwaltung der Beamten an Ort und Stelle, hob für die Uterthanen die lästige Frohndienste, und sogenannte Scharwerke auf, und verminderte die Abgaben. Die Lasten des Krieges an übermäßigen und immerwährenden Foderungen, Requisitionen, Lieferungen und Einquartierungen, erschienen für das Stift zu St. Emmeram unerschwinglich; aber Steiglehner wuste überall die nöthige Hilfe zu schaffen, und ungeachtet seit 1793 durch teutsche und französische Armeen die Kassen des Klosters oft erschöpft waren, hatten doch die Geistliche des Klosters nicht den geringsten Mangel zu leiden; mitten im Kriege wurden die Sammlungen von Münzen und Alterthümern vermehrt, und, wenn auch zugleich mehrere Hundert Mann einquartirt waren, der Unterricht und die Studien, der Gottesdienst, und die vorgeschriebene Ordnung im Innern des Hauses, weder unterbrochen, noch gestört. Am 23. April 1809 wurde sein Abteigebäude von den französischen Truppen 3 Stunden lang mit Haubitzgranaten beschossen, um die Stadt auf der südlichen Seite in Brand zu setzen, und in der folgenden Nacht seine Wohnung förmlich geplündert. Bis dahin, auch nach bereits eingetretener Säkularisation, blieben die Geistliche des Stiftes als pensionirt im Klostergebäude; da aber im Februar 1810 das Gebiet des Bistums Regensburg dem Königreiche Baiern einverleibt ward, erhielt Fürstabt Steiglehner das ehemalige teutsche Haus zur Wohnung, und trat seine sämtliche sehr schätzbare numismatische und antiquarische Sammlungen an die Königl. Baierische Hofkommission ab. Diese Sammlungen, wobei sich auch ein kostbarer Schatz von mehr als achthundert geschnittenen Gemmen, Bronzen, und andern Antiken befindet, wurden nicht zerstückelt, sondern kamen in das K. Münzkabinet nach München, wo sie, als zum Hausfideikommiß der Krone Baiern gehörig, unter dem Nahmen Cölestin Steiglehner’s aufbewahret werden. Im J. 1813 feierte er sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum. Er starb den 21. Februar 1819 in einem Alter von achtzig Jahren und sechs Monathen. Seine Wissenschaften, seine Tugenden, und seine Verdienste lassen das Andenken an ihn, und sein Lob nicht untergehen. Im Drucke erschienen von ihm:
Vergl. Will’s u. Nopitsch Nürnb. Gel. Lexikon B. VIII. S. 287-290. Meusel’s gel. Teutschl. B. VII. S. 628. u. B. XV. S. 529. Westenrieder’s Geschichte d. Baier. Akad. d. Wiss. B. II. S. 582. 613. und 623. Günthner’s Geschichte der literar. Anstalten in Baiern B. III. S. 208. Ignatz v. Streber’s Fortsetzung der Geschichte des K. Münzkabinets; in den Denkschriften der K. Akademie der Wiss. (München 1817.) B. V. S. 14--18. Schlichtegroll’s Rede zum Andenken Cöl. Steiglehner’s; in der Zeitschrift Eos (München 1819). n. 18. S. 70. n. 19. S. 73. n. 20. S. 78. u. n. 21. S. 81. Lipowsky Baierisches Musick-Lexikon (München 1811). S. 340. Mastiaux Literat. Zeitung f. kath. Relig. Lehrer (Landshut 1819.) B. II. S. 193--206. u. S. 209--221. Felder’s u. Waitzenegger’s Gel. Lexikon der teutschen kath. Geistlichkeit B. II. S. 369--392.
- 1. Positiones ex universa Philosophia et Mathesi. 4. Ratisb. 1768. 63 S. Positiones etc. ib. 1770. 57 S.
- 2. Observationes phaenomenorum electricorum in Hohengebrahim et Prifling prope Ratisbonam factae et expositae. 4. Ratisb. 1773. 55 S.
- 3. Atmosphaerae pressio varia, observationibus baroscopicis propriis et alienis quaesita. 4. Ingolst. 1783. 58 S.
- 4. Ueber die tägliche Abwechslung des Steigens und Fallens des Quecksilbers im Barometer; in den Ephemeriden Societat. Meteorol. Palat. anni 1782. Mannheim 1783.
- 5. Beantwortung der Preisfrage über die Analogie der Elektricität und des Magnetismus; in den neuen philosoph. Abhandlungen der Baier. Akademie der Wissensch. B. II. S. 227--350. Erschien auch in französischer Uebersetzung: Analogie de l’electricitè et du magnetisme, ou recueil de Memoires, couronnés par l’Academie de Baviere, avec des notes et dissertations nouvelles, par J. H. van Schwinden. 8. à la Haye 1785.
- 6. Von seinen Handschriften kam in die Königl. Hofbibliothek: Necrologium und Verzeichniß aller Mitglieder u. Wohlthäter des Stiftes zu St. Emmeram.
Vorheriger Eintrag |
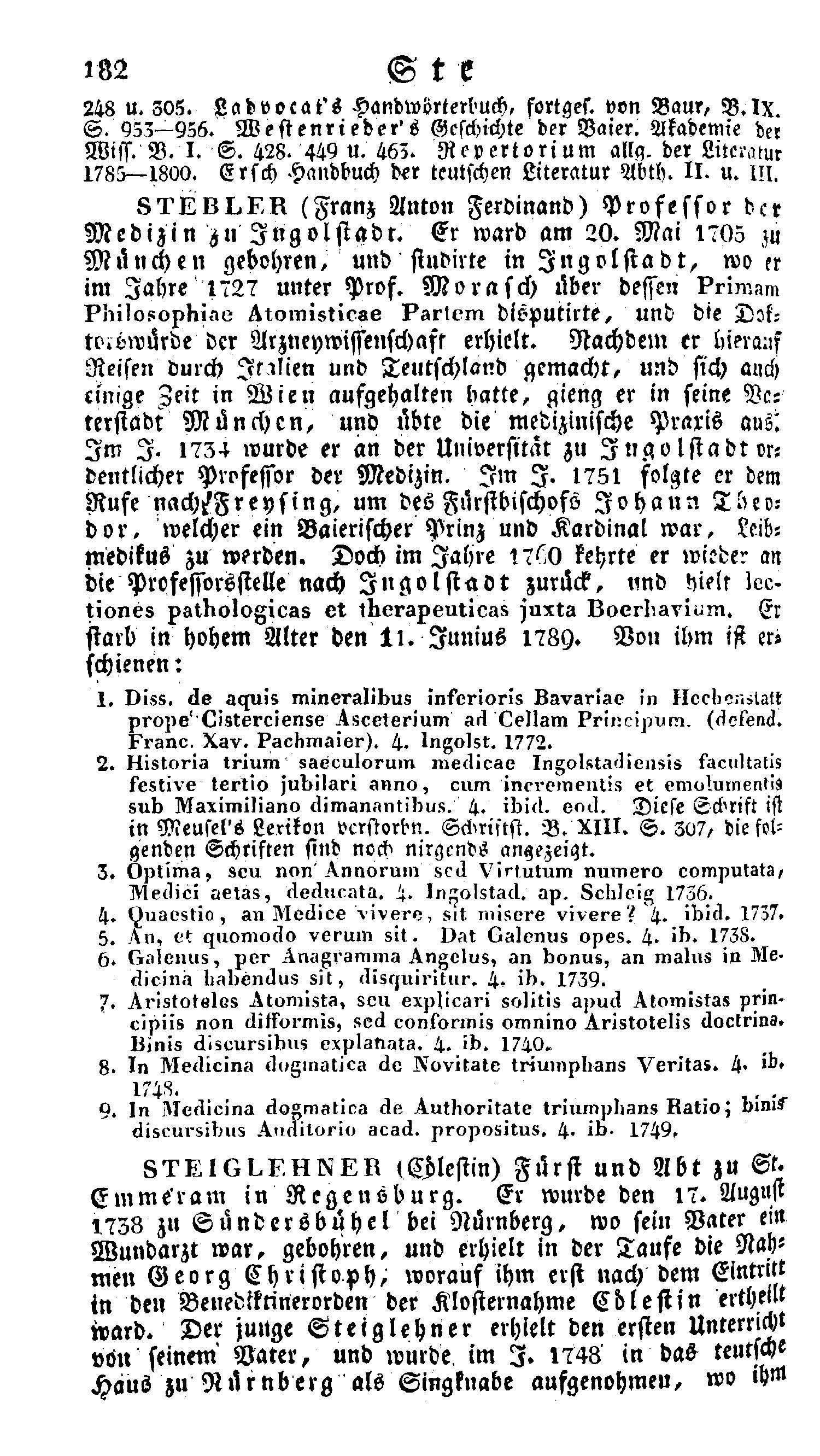 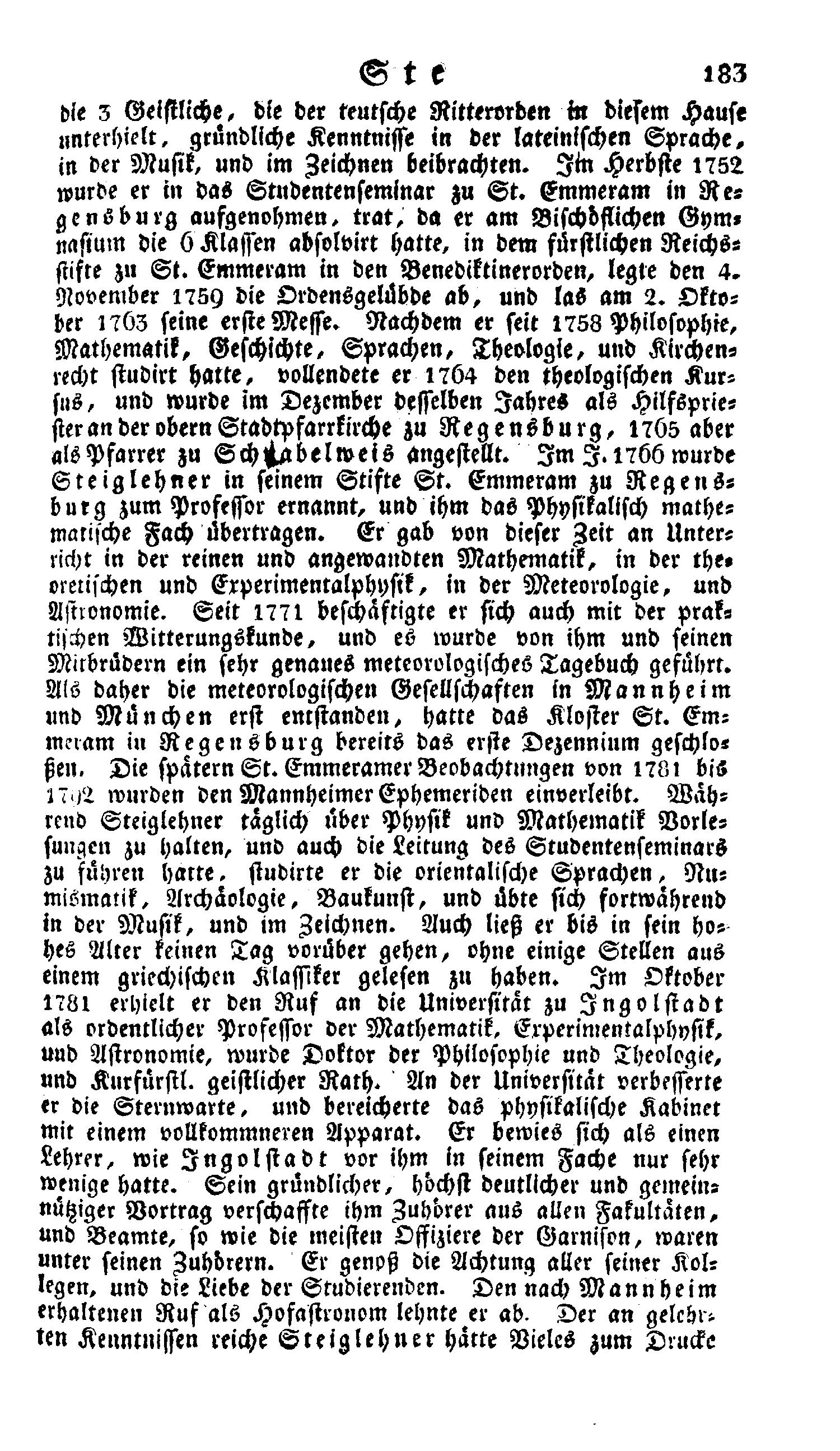 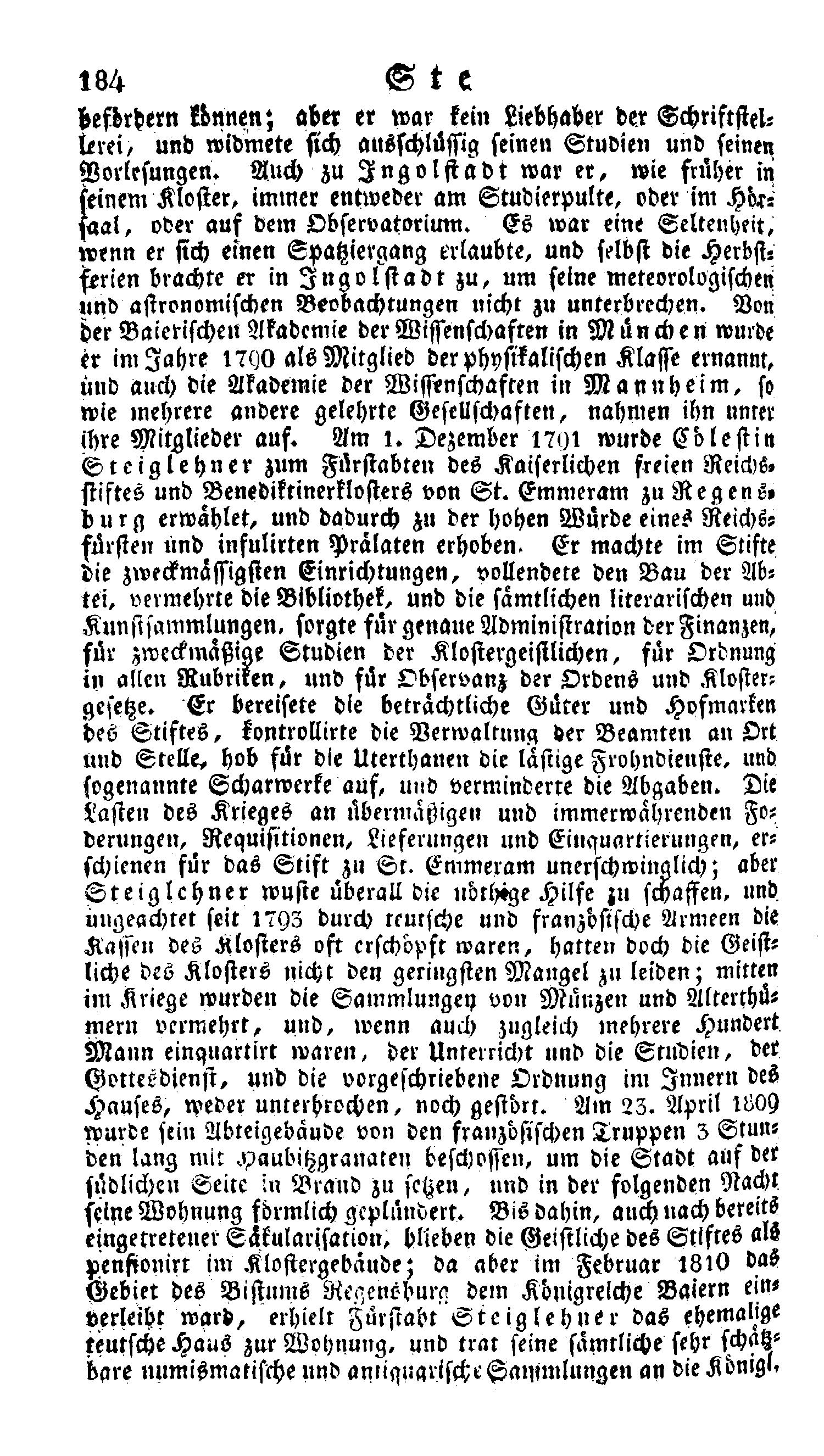 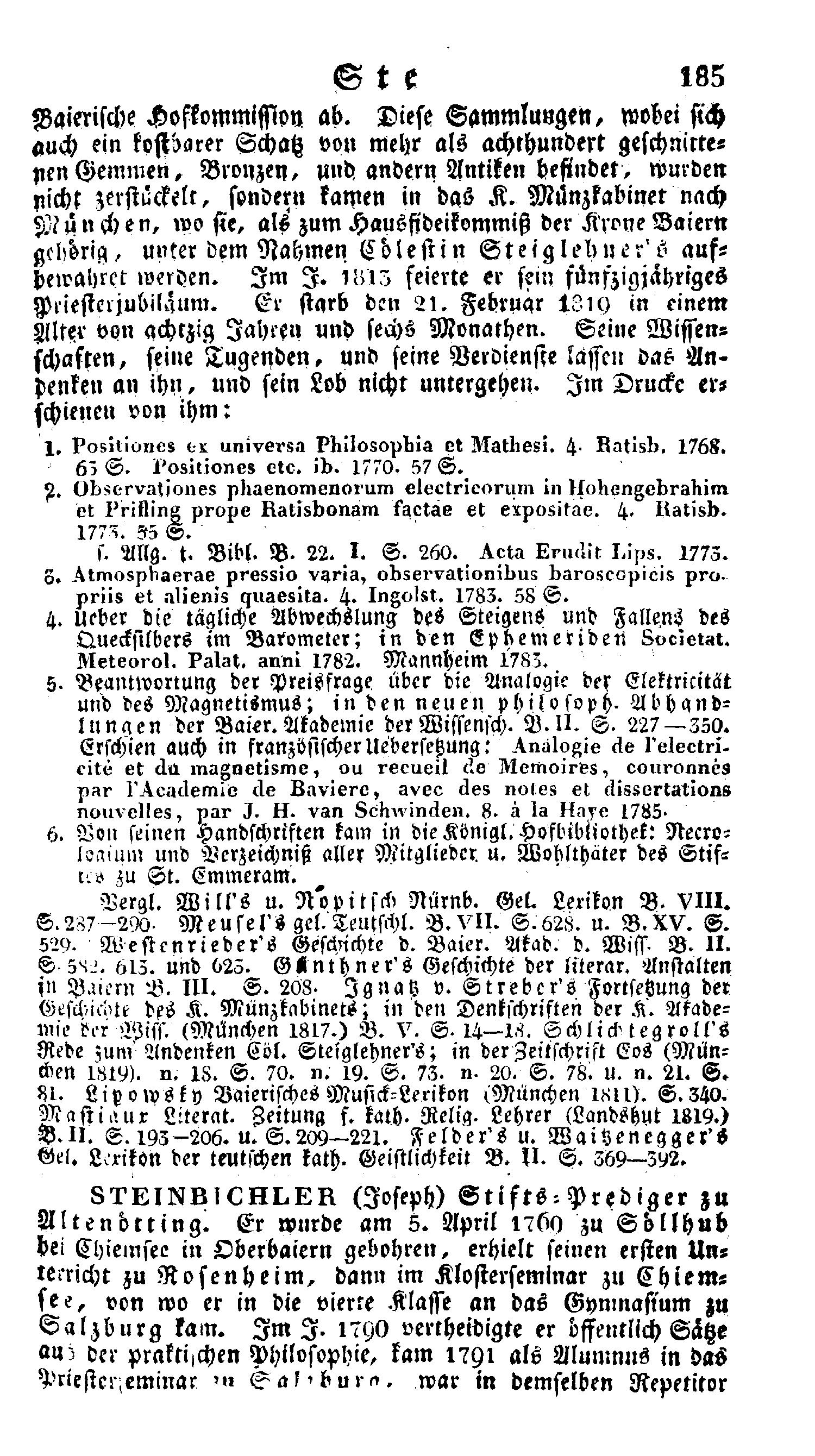
|
Nächster Eintrag |
Fußnoten
- ↑ s. Allg. t. Bibl. B. 22. I. S. 260. Acta Erudit Lips. 1773.